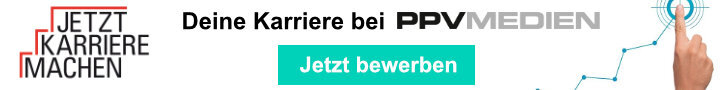die:mischbatterie: Die Kunst des Analogen
In seinem Studio "die:mischbatterie" verfolgt Engineer und Produzent Stephan Zeh einen ungewöhnlichen Ansatz beim Mischen – gegen die Transparenz, für die Energie.
Mit Bussen zum Erfolg
In Riedering am Simssee, nicht weit von Rosenheim in Oberbayern, betreibt Stephan Zeh „die:mischbatterie“. Das Studio genügt höchsten Ansprüchen und ist doch, wenn man so will, ein Heimstudio, befindet es sich doch im unterirdischen Anbau an Zehs Privathaus. Diese Konstellation wurde absichtlich so gewählt, wie der Musiker, Engineer und Studiobetreiber erklärt: „Ich bin Produzent, und wenn ich eine Idee habe und zum Beispiel ein Klavier aufnehmen möchte, dann will ich nicht erst zur Arbeit fahren müssen. So kann ich theoretisch im Schlafanzug ins Studio gehen und meiner Kreativität freien Lauf lassen.“

Natürlich hat Zeh nicht einfach von heute auf morgen beschlossen, jetzt Studiobetreiber zu werden. Angefangen hat er als Musiker zu Schulzeiten. „Damals war ich derjenige in der Band, der immer Überstunden machen und alles aufnehmen musste“, schmunzelt Zeh. Die Musikproduktion ließ ihn nicht mehr los und er machte eine Ausbildung an der SAE. Für seinen Bachelor of Recording Arts musste er auch ein Praktikum absolvieren, und so kam er in Leslie Mandokis Park Studios in Tutzing bei München. Bei der Erinnerung an diese ersten professionellen Erfahrungen muss Zeh lachen. „Ich sollte ein 70-stündiges Praktikum absolvieren, das hatte ich gefühlt am ersten oder zweiten Tag schon durch.“
Du bist nach dem Praktikum in den Park Studios geblieben?
Zeh: Fünf Jahre habe ich dort gearbeitet. Ich habe ganz klassisch als Assistent angefangen und hatte nach einem halben Jahr die Chance, ein Studio an mich zu reißen. Das war zuerst das Studio 3, ein Jahr später habe ich schon Studio 2 mitgestaltet. Schließlich war ich im Studio 1 derjenige, der für Leslie die Produktionen gemacht hat, von 2003 bis 2005.
Dann kam dein eigenes Studio?
Zeh: Ich hatte ja das Glück, in den Park Studios mit echten musikalischen Helden meiner Kindheit zu arbeiten: Bobby Kimball von Toto, Steve Lukather, Ian Anderson, Phil Collins. Solche Projekte konnte ich damals musikalisch wie tontechnisch mit betreuen. Das war eine aufregende und intensive Zeit, aber ich musste feststellen, dass ich nicht mehr so viel Zeit investieren konnte, auch weil ich Vater geworden bin. Ich habe damals in Rosenheim gewohnt und bin gependelt: Montag hin, Mittwoch mit sehr wenig Schlaf zurück. Donnerstag wieder hin und Samstag zurück. Also musste ich etwas ändern.
Zum Beispiel ein Studio eröffnen.
Zeh: Ich habe damals beschlossen, dieses Studio zu bauen und für mich eine Räumlichkeit zu schaffen, in der ich arbeiten kann. Das ist also hier kein klassisches Mietstudio, sondern es geht mir darum, wie ich die Sounds, die ich brauche, optimal erarbeiten kann.

Leckereien überall
Deshalb hat sich Zeh ein kleines Paradies geschaffen. Die Regie quillt über vor exquisitem Equipment. Die Outboard-Racks beherbergen Preamps, Kompressoren und EQs von so bekannten Namen wie Neve, Heritage Audio, Shadow Hills Industries, Gyraf Audio, API, Urei oder Chandler. Klassikern wie zwei Lexicon-Hallprozessoren oder den Distressoren von Empirical Labs stehen neuere Edel-Geräte wie der Bettermaker EQ 232 oder die API-500-Module von Inward Connections oder Standard Audio gegenüber. Weit verbreitete Prozessoren wie der Tube-Tech CL-1A treffen auf Exoten wie den Federal AM864. „Das ist ein irres Teil“, lacht Zeh. „Vor allem das Manual ist der Hammer. Da kannst du nachlesen, wie das Gerät zu zerstören ist, sollte es in feindliche Hände fallen. Das ist ein sehr dreckiger, zerrender Kompressor aus den USA. Der hat halt einen sehr mittigen Sound. Ich verwende ihn gern auf Vocals und Bass – zur Sättigung.“
Man muss schon sehr genau hinsehen, um alle Geräte in der Regie der Mischbatterie zu finden, denn nicht alles sitzt vorne im Rack. Auch auf der Rückseite des Rack-Tischs sind, ziemlich versteckt, feine Prozessoren verborgen: Ein Clariphonic EQ von Kush Audio verbirgt sich hier, ein Eventide Multieffekt und Preamps von Siemens/Telefunken ebenfalls. So edles Gerät kostet viel Geld.
Das Studio ist doch sicher nicht über Nacht entstanden, oder?
Zeh: Nein, auf keinen Fall! Was man hier heute sieht ist das Ergebnis von jahrelangem Aufbau. Ich bin jemand, der sich Anschaffungen lange überlegt und vor allem dann zuschnappt, wenn er ein gutes Angebot findet. Dann wird immer altes Equipment verkauft und damit neues, teureres Equipment teilfinanziert – so ist mein Studio gewachsen. Auch beim eigentlichen Studio-Bau habe ich viel selbst gemacht.
Du hast die Räume selbst gebaut?
Zeh: Ich wollte ein Studio bauen, das privat ist, wo man nicht in eine Gewerbehalle fahren muss. Wir haben also eine Betonkiste an unser Haus bauen lassen, und um den Innenausbau habe ich mich selbst gekümmert. Ich habe lange geplant, die Grundrisse überlegt. So ließ sich zum Beispiel die Treppe zum Studio nicht bis ganz unten bauen, weil sie ansonsten zu lang geworden wäre. Daher gibt es eine Art Podest im Eingangsbereich. Wenn man ein solches Podest hat, kann man es auch sinnvoll nutzen – also haben wir einen Bassreflex-Tunnel hineingebaut, der die Energie aus der Regie in den Maschinenraum ableitet.
Das hast du alleine geplant und gebaut?
Zeh: Hilfe hatte ich von einem befreundeten Engineer, Charly Bohaimid aus München. Der hat die Reinzeichnungen meiner Ideen gemacht und mich beraten. Es gibt so viele Details hier. Zum Beispiel die Höhe des Fensters zwischen Regie und Aufnahmeraum – das war ursprünglich nicht so geplant. Es musste aber so hoch werden, damit der Flügel durchpasst. Ein anderes Detail ist die Rückwand. Das ist eine Ziegelwand, in der die Ziegel um 90 Grad gedreht sind, sodass man durch den Ziegel quasi durchsprechen kann. Dahinter ist viel Dämmung mit unterschiedlichen Dicken. So werden verschiedene Wellenlängen wunderbar diffus gestreut und es wird dem Raum Energie entzogen. Die Front ist dagegen schallhart.
Ein Live-End-Dead-End-Prinzip also.
Zeh: Nun ja, das ist ja eher umgekehrt aufgebaut, mit dem toten Ende vorne. Ich bin allerdings ein Fan von der „schallharten Front“, und dadurch, dass wir hier nicht die möglichen Aufbau-Tiefen hatten, hätten wir sicher einen Meter Absorption gebraucht, um die Energie herauszubekommen. Durch das offene Prinzip der Rückwand sparen wir uns diesen Platz.
Langer Weg bis Barfuß
In den Raum hineingebracht wird die Energie von Barefoot MicroMain 27 MK2 als Nahfeld-Abhöre und großen ATCs. Doch bis er bei dieser Konstellation angekommen war, hatte Zeh einige Monitore gehört. Angefangen hat die:mischbatterie mit Geithain RL900 als Main-Monitors und Yamaha NS-10 als Nearfields.
Warum hast du deine Abhöre geändert?
Zeh: Ich habe festgestellt, dass ich mich während der Arbeitswoche immer mehr den NS-10 angepasst habe. Ich habe ja keinen Weg zur Arbeit und höre Musik eigentlich nur in dieser Regie. Das hat mich damals stutzig gemacht, also habe ich angefangen, zu suchen. Der Geithain ist ein toller, sehr angenehmer Lautsprecher, aber mir zu träge; da klang einfach alles großartig. Ich habe mir vieles angehört und war nie ganz zufrieden.
Woran lag das?
Zeh: Ich weiß nicht. Ich liebe Mitten und unterbewusst habe ich wahrscheinlich immer nach einer Abhöre gesucht, wie sie in den Park Studios vorhanden war: eine Boxer 412 im Studio 1 und eine große Quested in Studio 2, beide hatten diesen Mittentreiber, der eine tolle Impulsantwort hat. 2008 habe ich meine Geithains gegen die fantastischen MB-2 von PMC getauscht. Das war eine ziemliche bauliche Maßnahme, weil die Löcher in der Wand wieder geschlossen werden mussten. Die Lautsprecher stehen ja hier auf einem gesonderten Beton-Fundament, das komplett entkoppelt vom Rest der Regie ist.
Also hattest du dann MB2 und NS-10.
Zeh: Die MB-2 klingen toll, aber ich hatte immer das Gefühl, dass sie durch die Transmission-Line im Bass etwas spät sind. Die Lautsprecher sind mit ihren massiven Tiefbässen für Hip-Hop zum Beispiel bestimmt super; ich wollte aber etwas mittigeres. Dann habe ich die NS-10 gegen die Barefoot ausgetauscht. Da hat es für mich zum ersten Mal Klick gemacht. Die Barefoots sind kein angenehmer Lautsprecher, ganz im Gegenteil. Aber ich kann wunderbar damit arbeiten. Du hörst auf diesen Lautsprechern jeden Makel auf jedem Musikstück der Welt, und darum geht es ja. Das ist ein Arbeitswerkzeug – ein unfassbar brutales und direktes. Die Barefoot sind nicht dazu da, Musik zu genießen. Damit habe ich mich dann wieder wohlgefühlt.
Und wie kamen die ATC ins Studio?
Zeh: Nachdem ich mit den PMCs nicht zu 100 Prozent glücklich war, kam ich durch eine Empfehlung auf ATC. Das hat dann einfach gepasst, im doppelten Sinne: Die hatten dieselbe Größe wie die PMC, sodass sie hier genau in die Wand gepasst haben, und ich habe sie gehört und war begeistert. Ich liebe diesen Lautsprecher – vermutlich einer der besten Lautsprecher der Welt.

Technik und Musik
Mit einem solchen Lautsprecher kann man sich natürlich vergnügt der Musik widmen. Stephan Zeh ist dieser Aspekt besonders wichtig, da er sich nicht als reiner Techniker versteht – der musikalische Aspekt spielt eine wichtige Rolle für ihn. So ist für ihn auch seine Zeit in den Park Studios besonders wichtig.
Wie siehst du dich beruflich?
Zeh: Ich wollte anfangs nur Engineer und Mischer sein. Später habe ich bei Mandoki auch viele Dinge arrangiert und in dieser Richtung mitgearbeitet. Dadurch kam ich wieder mehr zur Musik. Heute, 15 Jahre später, ist der musikalische Anteil ein sehr großer. Ich denke auch, dass man im Recording noch viel intensiver arbeitet mit einem gewissen musikalischen Background-Wissen. Schon der Zusammenarbeit mit den Musikern tut es einfach gut, wenn man die musikalische Seite abrufen kann.
Ein Recording-Engineer sollte immer auch Musiker sein?
Zeh: Das würde ich gar nicht so sagen. Bei mir trifft sich das hervorragend, aber es gibt sicher auch tolle Engineers, die keine Musiker sind. Ich schöpfe aber sehr viel Energie daraus.
Wie würdest du bei dir das Verhältnis zwischen dem Musikalischen und dem Technischen einschätzen?
Zeh: Das hängt vom Projekt ab. Es gibt ja Projekte, bei denen ich nur als Dienstleister die technische Seite betreue. Wenn ein Projekt es braucht oder zulässt, kann ich mich eben auch musikalisch einbringen. Aber in genauen Zahlen kann man das nicht ausdrücken. Es gibt ja Projekte, die ich komplett produziere, da laufen die beiden Seiten auch zusammen.
Deine Arbeit beginnt also teils beim Songwriting und geht bis hin zum Mastering?
Zeh: Schon, ja. Bei eigenen Produktionen gebe ich das Mastering gern auch aus der Hand und hole mir eine zweite Meinung. Aber wenn ich gebeten werde, dann mache ich auch mal ein Mastering. Ich biete das aber nicht von mir aus an. Ich habe ja auch keine Werbe-Broschüre in dem Sinne.
Eine Broschüre braucht Zeh auch nicht, die Aufträge finden ihn. So ist er in der glücklichen Position, sich die Projekte aussuchen zu können, an denen er arbeiten möchte. Ein solches Projekt ist Singer-Songwriter Alex Diehl, mit dem Zeh seit 2011 zusammenarbeitet und dieses Jahr bei der Vorausscheidung für den Eurovision Song Contest den zweiten Platz belegen konnte. „Das ist natürlich toll“, freut sich Zeh, „wenn man so ein Projekt vom ersten Vorsingen bis hin zum zweiten Album und zum ESC-Vorentscheid begleiten darf“. Aber auch kleinere Produktionen haben ihren Reiz für den Mischbatterie-Betreiber nicht verloren. „Das kann auch mal was ganz Kleines sein, wo man vier Tage lang einer Jazz-Band einfach einen guten Sound macht und nicht nachts schweißgebadet aufwacht, weil man sich fragt, ob der Gsus4-Akkord der richtige für den Pre-Chorus ist“, sagt er, lacht und fügt hinzu: „Zur Zeit arbeite ich mit einer Münchner Band, das macht irre Spaß. Wir haben auf Tape aufgenommen, ungeschnitten, uneditiert, rough, kaum Gitarren-Doppelung. Das hat einfach eine ganz andere Attitüde.“
Busfahrer
„Attitüde“ ist ein interessantes Wort, bezeichnet Zeh seine Herangehensweise doch als „Mixing with attitude“. Es geht ihm nicht darum, technische Parameter abzuarbeiten – Zeh möchte einen Song durch die Elektronik mit den vielen Knöpfen an den Punkt bringen, wo er im Hörer etwas auslöst. „Das ist auch der Grund, weshalb ich noch analog arbeite“, erzählt er. „Manchmal verfluche ich diesen Wahnsinn, weil ich einfach das Pult immer am Start haben muss.“
Du gehst also viel über das Pult?
Zeh: Ich arbeite ja mit enorm vielen Bussen – auch parallel. Die bilden bei mir aber nicht so sehr einzelne Instrumenten-Gruppen ab. Es geht mir eher darum, in welcher Kombination mit welchem Gerät Drums und Bass zum Beispiel am besten funktionieren. Ich hasse Transparenz. Das klingt erstmal provokant, aber ich mag es nicht, wenn ein Bass nicht mit der Musik arbeitet. Für meinen Sound verflechte ich gerne die Instrumente zu einem Netz, das wird fast schon eine Art biologische Masse. Ich mag, wenn es etwas schmutzig klingt. Wenn es nicht einfach nur digital sauber funktioniert – das können viele andere, ich kann das vielleicht gar nicht.
Guter Sound darf also „suboptimal“ sein?
Zeh: Ich denke schon. Ich arbeite auch fast nie mit irgendwelchen Referenz-Produktionen. Ich versuche, für den jeweiligen Act etwas zu entwickeln, was passt. Das kann etwas ganz anderes sein als bei der Produktion, die danach kommt. Es ist wichtig, dass eine Produktion eine eigene Signatur bekommt. Ich habe lange versucht, „dem perfekten Sound“ nachzujagen. Natürlich muss der Sound ordentlich sein, aber man muss in erster Linie etwas finden, was dem Anspruch oder der Aussage des Songs gerecht wird.
Hast du ein Beispiel aus deiner Arbeit?
Zeh: Da fällt mir Xavier Darcy ein, ein Singer-Songwriter aus München. Das ist noch Underground, ohne Label dahinter. Das Wesentliche waren hier sein Gesang und seine Akustikgitarre. Drumrum haben wir alle Instrumente rein unterstützend aufgebaut und zum Beispiel kaum Direktsignale bei den Drums verwendet, um nie von seiner Performance abzulenken. Trotzdem hatten wir am Ende eine fette „Wall of Sound“. Man entscheidet sich ja schon während des Produktions-Prozesses für eine bestimmte klangliche Signatur.
Wie arbeitest du dann im Mix?
Zeh: Ich habe schon damals in den Park Studios auf einem Aux-Weg immer ein bestimmtes Preset vom Lexicon bereit gehabt, das ich stark komprimiert oder sogar verzerrt habe. Wenn mir dann irgendwo der Kleber gefehlt hat, konnte ich damit zum Beispiel die Lücke schließen. Der Effekt hat die Signale vermengt. Irgendwann hat mir das auch nicht mehr gereicht, so kamen Stück für Stück Dinge hinzu. Mittlerweile fahre ich ein sehr intensives Multibus-Konzept.
Was meinst du damit?
Zeh: Mir geht es darum, herauszufinden, wie man Synergie-Effekte zwischen einzelnen Instrumenten finden kann. Das geht deutlich weiter als der übliche Instrumenten-Bus, auf dem ein Kompressor liegt. Stattdessen arbeite ich mit einer Art von „Energie-Bussen“. Das sind Busse, die eine gewisse Signatur bieten und mal gut für die Drums funktionieren, mal aber auch gut mit dem Bass. Das kann dann bei jeder Produktion unterschiedlich sein. Jedenfalls arbeite ich im Grunde immer über Send-Return, ich habe kaum noch Inserts. Auf diese Weise muss ich nichts umstecken und ich kann entscheiden: Was mache ich mit dem Piano? Kommt es auf eine der Stereo-Summen? Oder schicke ich es auf einen der Busse? Ich habe mir immer zwei Busse zu Stereo-Paaren zusammengestellt. Ein Bus komprimiert im VCA-Stil, auf einem anderen sitzt ein Röhren-Limiter, den ich liebe. (Ein Inward Connections TSL-4 Vac Rac – Anm. d. Red.) Ein weiterer Bus produziert Distortion über meine Standard Audio Level-Ors.
Heißt das, du stellst die Geräte gar nicht großartig ein?
Zeh: Wenn ich ein Gerät kaufe, dann finde ich irgendwann eine Einstellung, die mir gefällt, und so bleibt das dann auch. Es gibt dann vielleicht einmal ein zweites Setting, aber das war's. Die Level-Ors sind seit zwei Jahren da hinten im Rack. Die Sound-Suche funktioniert dann komplett vom Pult aus: Wie viel Gain schicke ich zu dem jeweiligen Bus und wie laut fahre ich den Bus in den Mix? Für meinen Vocal-Sound habe ich mittlerweile acht feste Busse, mit denen ich arbeite.
Wie bist du auf diesen Weg gekommen?
Zeh: Früher habe ich nur über Inserts gearbeitet. Ich kam dann auf der Suche nach Lautheit zu diesem Weg. Ich hatte damals das Problem, dass ich oft zu leise gemischt habe. Das hat mir ein oder zwei Jahre Kopfzerbrechen bereitet, man bekommt schließlich keine Jobs, wenn man zu leise ist. Für mich funktioniert es nicht, einen guten Mix am Ende mit einem Limiter um 6 dB aufzupumpen. Das ist nicht mein Sound, das klingt bei mir nicht gut. Ich hatte immer das Gefühl, das zerstört mir die Basis-Wellenform zu sehr. Also war mein Umkehrschluss: Ich fahre diejenige Energie parallel dazu, die ich final auch für Lautheit brauche – vielleicht wie ein Wasserbecken, das immer voller wird.
Und das steuerst du alles über das Mischpult?
Zeh: Das ist die Ex-Konsole von Harold Faltermeyer, die kommt aus der Zeit von 1995 und war damals Mischpult-Oberklasse. Eine Euphonix, ein Hybrid aus einer CS2000 und einer CS3000. Das Konzept ist sehr modular, komplett analog aufgebaut und digital ferngesteuert. Dadurch ist das Pult enorm flexibel. Insgesamt hat die Konsole 96 Vorverstärker für Mic und Line mit Phantomspeisung, Phasendreher und Pad – allerdings nutze ich die fast nie, weil ich vor allem über Outboard tracke: V76, Neves, im Aufnahmeraum das Rack mit den Telefunken-Kassetten und so weiter.
Links:
Tags: Interview